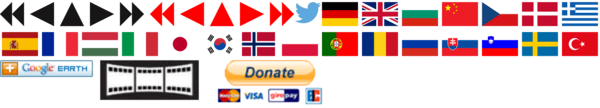Gastbeitrag von Jefffrey H. Michel zu CCS, Braunkohle in Deutschland und den daraus folgenden Problemen der deutschen Klimapolitik.
| Deutschland fördert 175 Millionen Tonnen (Mt) Braunkohle
|
|
|
pro Jahr zur Erzeugung eines Viertels seines Stroms (150 TWh/a) in Braunkohlekraftwerken mit einer Gesamtleistung von 22 GW. Die meisten Kraftwerke befinden sich
|
| Braunkohle wertlos für den Export
|
|
|
Der Heizwert liegt bei 7,8 bis 10,5 MJ/kg, die Hälfte von Brennholz. Im Vergleich zur Steinkohle (27 - 33 MJ/kg) wird die dreifache Braunkohlemenge zur Erzeugung
|
| Zusammensetzung Braunkohle
|
|
|
Die geförderte Rohbraunkohle besteht zu einem Drittel aus elementarem Kohlenstoff, während die übrige Masse mit Grundwasser, mineralischen Ballaststoffen und Schwefel
|
| Braunkohlekraftwerke und Tagebau
|
|
|
Diese Anlagen emittieren zusammen 57 Millionen Tonnen CO2/a. Die Braunkohle wird aus den eigenen Tagebauen des Unternehmens sowie von der MIBRAG Bergbaugesellschaft
|
| CCS nicht konkurrenzfähig?
|
|
|
Sollte CCS in der Europäischen Union vorgeschrieben oder subventioniert werden, was ein mögliches Ergebnis von insgesamt 12 derzeit laufenden Pilotprojekten wäre,
|